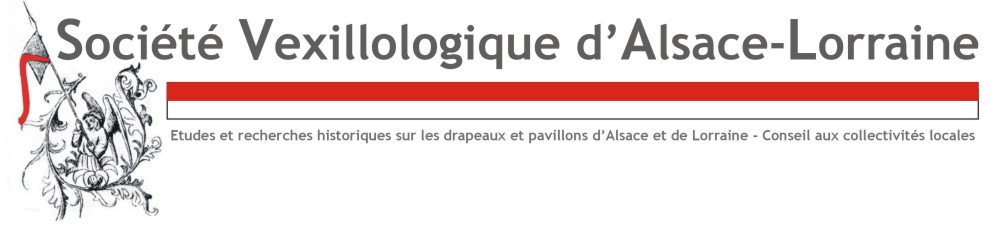
|
|
|
Die Landesfarben für Elsaß-Lothringen. Albert Uhlhorn, Kaiserl. Notar in Saarunion.
In
„Elsässische Monatsschrift für Geschichte und Volkskunde“,
Es bestand von jeher ein Bedürfnis, für Staaten, Provinzen oder Städte ein einheitliches Zeichen zu schaffen, welches nach außen hin in allgemein verständlicher Weise das Ganze, dem der Einzelne in dem betreffenden Lande, Landesteil oder Orte angehört, repräsentiert. Diese Zeichen sind einerseits die Wappen, andererseits die Flaggen der betreffenden Allgemeinheiten und von diesen wiederum sind es die Flaggen, die in ihrer verhältnismäßig einfachen Zusammensetzung und dadurch erzielten leichten Fasslichkeit bei denjenigen, die zu ihrer Verwendung irgendwie berechtigt sind, also vor allen Dingen bei den einzelnen Bürgern selbst, am meisten Verwendung finden. Ein Wappen ist im Vergleich zur einfachen Farbenfahne immer etwas kompliziertes und sein richtiger Aufriss bedingt eine Menge spezieller Kenntnisse auf heraldischem Gebiet, die leider bei den Herstellern von Wappen nicht immer vorhanden sind. Ganz anders mit der Fahne! Hier handelt es sich um Verwendung von zwei oder drei Farbenstreifen in bestimmter Reihenfolge, die sich leicht einprägen und sich daher viel mehr zur Schaffung eines Symbols eignen, welches jedem Einzelnen seine Zugehörigkeit zum Ganzen ins Bewusstsein zu rufen imstande ist. Die Frage nach einem gemeinsamen Symbol hat aber nicht nur eine praktische, sondern vor allen Dingen eine ideale Seite und es zeugt von gesundem Partikularismus, wenn eine juristisch oder politisch geschaffene Vereinigung von Personen zu Gemeinden, Provinzen oder Staatengebilden ein solches Gemeinzeichen mangelt und erstrebt. Durch Reichsgesetz vom 31. Mai 1911 hat das Reichsland Elsass-Lothringen eine Vertretung im Bundesrat, sowie eine Verfassung erhalten und ist damit im Großen und Ganzen den übrigen deutschen Bundesstaaten gleichgestellt worden. Es erhebt sich damit von neuem und dringender die Frage nach den gemeinsamen Symbolen, und der Flagge. Wie steht es hiermit? Da das Reichsland vor 1870 niemals, wenigstens nicht mehr seit der Zeit, als das Wappenwesen geschaffen wurde, ein einheitliches Staatengebilde war, so ermangelt es auch naturgemäß ein einheitlichen Wappens. Wohl waren solche für die drei Bezirke, die Landgrafschaften Ober- und Unter-Elsass und das Herzogtum Lothringen, vorhanden, ein gemeinsames Wappenzeichen fehlte aber und wurde auch nach 1870 zunächst nicht geschaffen. Im Laufe der Jahre wurde jedoch das eingangs erwähnte Bedürfnis immer größer. Es entstanden verschiedene Vorschläge, welche teils die Wappen der Städte Straßburg und Metz, teils die Wappen der einzelnen Landesteile als Unterlage nahmen. Da erging am 29. Dezember 1891 ein kaiserlicher „Erlass betreffend die Bestimmung eines Wappenzeichens für das Reichsland Elsass-Lothringen“ welcher am 9. Februar 1892 veröffentlicht wurde. Hierdurch wurde als Wappen bestimmt der Reichsadler mit der schwebenden Kaiserkrone, belegt mit einem gespaltenen Brustschilde, dessen rechte Hälfte die herkömmlichen Wappen des Ober- und Unter-Elsass und dessen linke Hälfte das entsprechende Wappen von Lothringen enthält. Dem Erlass war eine Farbenskizze beigefügt, welche im Archiv des Ministeriums hinterlegt wurde. Wenn wir diese Farbenskizze zu Grunde legen, beschreibt sich das Wappen des Reichslandes also nunmehr wie folgt: Unter schwebender Kaiserkrone der schwarze rot bewehrte Reichsadler, belegt mit einem von einer Fürstenkrone bedeckten gespaltenen Schild. Die rechte Seite des Schildes ist geteilt und zeigt oben in Rot einen goldenen Schrägbalken, beiderseits begleitet von je drei goldenen Kronen (die unteren gestürzt) (Landgrafschaft Ober‑Elsass); unten in Rot einen silbernen, beiderseits mit silbernen Kronenreifen besteckten Schrägbalken (Landgrafschaft Unter-Elsass). In der linken Schildhälfte erscheint im goldenen Felde ein roter mit drei silbernen schräg gelegten gestümmelten kleinen Adlern belegter Schrägbalken (Herzogtum Lothringen). Aus Gründen der heraldischen Courtoisie sind die Elsässer Schrägbalken nach innen, dem Lothringer zu, geneigt, während sie sonst, — allein dargestellt — ebenso wie der Lothringer, also als Rechtsschrägbalken verlaufen. Das Wappen versinnbildlicht durch die Verbindung der Wappen der drei Landesteile mit dem Reichsadler ganz glücklich den Gedanken des Elsass-Lothringens als Reichsland und ist historisch richtig dargestellt, wenn auch vom heraldischen Standpunkt aus manches auszusetzen wäre und insbesondere die plastisch unmögliche Anbringung der unhistorischen Fürstenkrone Anlass zu berechtigter Kritik gab. Wie sehr die Schaffung eines gemeinschaftlichen Wappens dem Bedürfnis entsprach, zeigt die vielfache Verwendung desselben in seiner jetzigen Gestalt, sei es mit oder ohne Reichsadler, nicht nur durch die Behörden und zu offiziellen Zwecken, sondern auch durch Private. Man hätte nun meinen sollen, dass, da durch die Verleihung eines Wappenzeichens das Bedürfnis nach einem solchen anerkannt war, man auch dem, wie oben ausgeführt, intensiveren Bedürfnis nach Schaffung einer gemeinsamen Flagge entgegengekommen wäre und dem Reichsland seine Fahnenfarben gegeben hätte. Dies ist aber nicht geschehen. Während sämtliche Bundesstaaten, in Preußen seit 1892 auch sämtliche Provinzen, offiziell anerkannte bzw. verliehene Flaggen besitzen, ermangelt das Reichsland bis heute einer solchen. Wohl sind seit Verleihung eines gemeinsamen Wappens für das Reichsland Bestimmungen über Flaggen getroffen worden, die eventuell hier in Betracht kommen konnten. Zunächst erschien am 8. November 1892 eine Verordnung über die Führung der Reichsflagge. Dieselbe wiederholt im §1 die Bestimmung, wonach die Bundesflagge des Norddeutschen Bundes die deutsche Nationalflagge bildet, und bestimmt dann weiter, dass diejenigen Reichsbehörden, welche nicht die Kriegsflagge zu führen haben, eine besondere Reichsdienstflagge in Gebrauch zu nehmen haben. Laut §4 sind aber zur Führung dieser Reichsdienstflagge nur die Behörden des Reichs befugt. Da die lothringischen Behörden zwar „kaiserliche“ aber doch „Landes“-Behörden sind, so traf obige Verordnung auf sie nicht zu, soweit von einer Reichsdienstflagge die Rede ist. Es wurde deshalb diesen Behörden durch kaiserlichen Erlass „betreffend die von den elsass-lothringischen Landesbehörden zu führende Dienstflagge“ vom 22. Mai 1893, veröffentlicht am 7. Juni 1893, eine besondere Dienstflagge verliehen, deren beigefügtes Muster ebenfalls dem Archiv des Ministeriums einverleibt wurde. Diese Fahne ist die deutsche Nationalflagge schwarz-weiß-rot, trägt jedoch in der dem Flaggenstock zugekehrten Ecke des schwarzen Streifens den elsass-lothringische Mittelschild mit der Fürstenkrone des Landeswappens (also Mittelschild ohne den Reichsadler). Es ist nun klar, dass dieser Erlass keine elsass-lothringische Landesflagge schaffen wollte oder geschaffen hat, wie er ja auch ausdrücklich von einer „Dienstflagge” der Landesbehörden spricht, wenn auch eine den ausschließlichen Gebrauch dieser Flagge durch die Behörden festsetzende Bestimmung, wie dies bei der ersterwähnten Verordnung geschehen, fehlt, so dass es mindestens zweifelhaft sein kann. ob nicht auch Private sich dieser Flagge bedienen können. Die Flagge für Elsass-Lothringen ist also noch zu schaffen! Bevor wir nun das „Wie“ dieser Frage erörtern, dürfte es sich empfehlen, zunächst einmal die allgemeinen Grundsätze kennen zu lernen, nach welchen eine Flagge gebildet wird. Da ist es nun offenbar, dass der Ursprung der Flaggenfarben in inniger Verbindung steht zur Heraldik Fällen oder die Farben Wappenkunde, derart dass in den überwiegenden Fällen die Farben der Fahne denjenigen des Wappenschildes oder wenigstens des Stammwappens entsprechen. So ist dies der Fall bei der Flagge von Preußen, Bayern, Hansestädten. Baden, Weimar, Oldenburg, Lippe, Reuß und den Hansestädten. Oder die Farben werden den einzelnen Wappenbildern entnommen, wie bei Braunschweig und Hessen, auch Württemberg, oder aber es wird den Farben des Stammschildes die Farbe des Wappenbildes eines anderen zugehörigen Schildes beigefügt, wie bei Waldeck. Manchmal ist die Bezugnahme auf ein Wappen nicht immer gleich ersichtlich, indem die Farben aus zwei verschiedenen Wappen- oder Flaggenfarben zusammengezogen wurden. Als klassisches Beispiel dienen hierfür die Nationalflaggen von Deutschland und Frankreich. Die deutsche Nationalflagge — schwarz-weiß-rot — war ursprünglich die Bundesflagge des Norddeutschen Bundes und ist entstanden aus der Verbindung der Flagge Preußens schwarz-weiß mit derjenigen der Hansestädte weiß-rot. Da die Flagge ursprünglich nicht als Nationalflagge, sondern als Seeflagge gedacht war, so erklärt sich diese Verbindung der Farben Preußens mit denen der Hansa sehr einfach. Die französische Nationalflagge ist in der Revolution entstanden, als es sich um die Schaffung einer Nationalkokarde handelte im Gegensatz zur weißen Kokarde der Bourbonen. Eine zuerst vorgeschlagene grüne Kokarde wurde verworfen, weil dies die Farbe der Livree des Grafen von Artois war, und man wählte die Schildfarben von Paris, blau und rot. Nach der Erstürmung der Bastille wurde dann „en signe de réconciliation avec le roi” diese Kokarde der weißen des Königs aufgelegt und die dadurch geschaffene Trikolore blau-rot-weiß später in blau-weiß-rot umgeändert. Andere Landesflaggen wurden dadurch gebildet, dass zu bereits bestehenden Farben eine neue ohne Bezugnahme zum Wappen hinzutrat. So fügte Sardinien 1848, als es sich an die Spitze der italienischen Bewegung setzte, seiner rot-weißen Flagge grün bei, um dadurch die seither erfüllte Hoffnung auf ein einheitliches Italien zu symbolisieren. Auch die Farben des Deutschen Bundes von 1848 — schwarz-rot-gold — erklären sich aus der Verbindung der alten Reichsfarben schwarz-gold mit dem Rot des roten Schwenkels oder Wimpels, welcher oben an der Reichssturmfahne angebracht war. Andere Landesfarben erklären sich aus historischen Gründen. So führt Österreich heute noch die Farben des Heiligen Römischen Reiches schwarz-gelb, und die Niederlande die französische Trikolore (wenn auch in umgekehrten Reihenfolge und in waagrechter Stellung), welche bei Proklamierung der batavischen Republik im Mai 1795 hierher verpflanzt wurde. Also auch hier kommen wir im letzen Grunde bei Wappenfarben an. Schließlich können Flaggenfarben auch rein willkürlich gewählt werden. So dekretierte König Friedrich August von Sachsen am 16. Juni 1815 die weiße Kokarde mit grünem Rand als Nationalkokarde, und die sächsischen Herzogtümer, sowie Anhalt folgten mit der Annahme der neuen Landesfarben weiß-grün. Die Fürstentümer Schwarzburg führen in neuerer Zeit die Landesfarben blau-weiß, anstatt wie früher die Wappenfarben blau-gelb. Es ist aber anzunehmen, entnommen und nur das Weiß und Blau dem Wappen willkürliche Zutat ist. Fassen wir das Gesagte zusammen, so sehen wir, dass die Farben des Wappens immer und stets eine Rolle spielen, selbst dann noch, wenn auf den ersten Blick eine Abweichung von dieser Regel vorliegt. Wenn also bei Aufstellung einer neuen Flagge die Heraldik die Hauptlehrerin sein muss, so müssen wir auch ihre Gesetze bei der Zusammensetzung der Flagge beobachten. Demgemäß ist an Folgendem festzuhalten: Was zuerst die Farben selbst anlangt, so kennt die Heraldik eigentlich nur vier Farben, rot, blau, grün schwarz, wozu vielleicht noch Purpur käme, und zwei Metalle, Gold und Silber. Die Farben selbst sind ungemischt, in satten Tönen zu wählen, damit sie auch aus der Ferne schon gut unterschieden werden können und keinen Anlass zu Missverständnissen und Verwechslungen geben. Aus demselben Gesichtspunkt entstand die weitere Regel, dass Farbe nicht auf Farbe, Metall nicht auf Metall zu stehen kommen soll, sondern nur Farbe auf Metall und umgekehrt. Wenden wir diese Regeln auf die Flaggen an, so ist zunächst zu bemerken, dass bei diesen die Metalle Gold und Silber fast durchweg durch die Farben Gelb und Weiß ersetzt werden, wie dies ja auch manchmal bei den Wappen selbst geschieht. Da aber diese Farben lediglich aus praktischen Gesichtspunkten, demnach nur hilfsweise an Stelle der Metalle treten, so unterliegen sie den Gesetzen für die Metalle, gelten also eigentlich nicht als Farben. Bei den Flaggen nun treten die praktischen Erwägungen, welche die obigen Regeln haben entstehen lassen, in noch viel höherem Maße in den Vordergrund, wie bei den Wappen. Es sollten deshalb alle Mischfarben, ebenso rosa oder hellblau vermieden werden, desgleichen das Nebeneinanderstellen zweier Farben oder zweier Metalle (weiß und gelb). Tatsächlich kommen in der Praxis Verstöße letzterer Art nur selten vor, z.B. Württemberg und Kirchenstaat, während die Verwendung von Mischfarben und helleren oder dunkleren Tönen in neuester Zeit leider sogar amtlich sanktioniert wird. Anlangend die Reihenfolge der Farben, so gebührt der Farbe des Schildbildes der Vorrang (sie ist die vornehmere) vor derjenigen des Schildes selbst. Ist kein eigentliches Schildbild vorhanden, d.h. ist der Schild lediglich durch Spaltung, Teilung oder Schrägteilung ein- oder mehrfach in verschiedene Farbenflächen zerlegt, so gilt als Regel, dass die (heraldische) rechts oder die oben stehende Farbe die vornehmere ist. Mit dieser vornehmeren Farbe ist zu beginnen, sie bildet den oberen Streifen der Flagge. Die Farben der Stadt Straßburg z.B. sind daher rot-weiß, nicht weiß-rot, die von Metz weiß-schwarz nicht schwarz-weiß. Bei dem Wappenbild ist nur die Hauptfarbe zu berücksichtigen, daher z.B. andersfarbige Aufschläge an Mützen und Kleidern oder Waffen bei Menschen, Bewehrung (Zunge und Krallen, Schnabel und Fänge u. dergl.) und Bekrönung bei Tieren, Besamung und Belaubung bei Pflanzen beim Entwurf der Fahnenfarben nicht in Betracht kommen. Es sind demnach z. B. die Farben von Hagenau weiß-blau, nicht rot-weiß-blau, diejenigen von Gebweiler rot-weiß, nicht rot-blau-weiß. Hierher gehören auch die so genannten „Beizeichen“, welche dem eigentlichen Stammwappen zur Unterscheidung der einzelnen Linien oder Bastardlinien beigefügt werden. Da die Länderwappen häufig aus Geschlechtswappen entstehen, so können auch diese Beizeichen bei der Schaffung von Flaggen für diese Länder praktisch werden. Selbstverständlich erleiden alle diese Regeln Ausnahmen. So wird die rote Bewehrung der goldenen Löwen im schwarzen Felde der Wappen von Belgien und Reuß als rote Farbe in die Flagge mitübernommen, wobei ich dahin gestellt lassen will, ob nicht der Wunsch nach Schaffung einer Trikolore mitbestimmend war, was jedenfalls bezüglich Belgien der Fall gewesen sein wird. Endlich wäre noch ein Punkt zu erwähnen, das ist die Stellung der Fahnenstreifen zum Flaggenstock. Hierzu ist zu bemerken, dass die wagerechte Stellung, also senkrecht zum Flaggenstock, bei weitem überwiegt, während die senkrechte Stellung, also parallel zum Flaggenstock, die Ausnahme bildet. Letztere findet sich nur bei Mexiko, Frankreich, Belgien, Italien, Rumänien, Bolivien, Guatemala, Peru, ferner bei Portugal und Andorra, den Schweizer Kantonen Neuenburg und Schaffhausen und endlich bei Reuß-Schleiz, also abgesehen von den beiden letzten nur in romanischem Gebiete. Damit ist die Liste erschöpfend aufgezählt. Es ist zweifellos, daß die an genannten der französischen Trikolore nachgebildet sind während sich bei Neuenburg die Stellung aus dem Wappenbild herleitet. Bei Reuß-Schleiz endlich scheint die senkrechte Stellung als Unterscheidungsmerkmal von Reuß-Greiz gewählt worden zu sein, das dieselben Farben wie Reuß-Schleiz, aber in wagerechter Stellung zeigt. Ist demnach die senkrechte Stellung der Streifen (also parallel mit dem Flaggenstock) als verschwindende Ausnahme zu bezeichnen, die außerdem fast durchweg auf historischen Gründen beruht, so darf bei Schaffung einer neuen Fahne von der Regel einer wagerechten Teilung (also senkrecht zum Flaggenstock) ohne Not nicht abgegangen werden. Die Nationalflagge des Deutschen Reichs, die Wappen sämtlicher Bundesstaaten (mit alleiniger Ausnahme von Reuß-Schleiz) und diejenigen sämtlicher preußischer Provinzen haben wagerechte Stellung der Streifen, die neu zu schaffende Flagge des Reichslandes muss daher dieselbe Form zeigen. Wir kommen jetzt zu der Frage: Was wurde bisher an Stelle einer Landesflagge geführt? Wie bereits oben erwähnt, hat der kaiserliche Erlass vom 22. Mai 1893 für die elsass-lothringischen Landesbehörden eine Dienstflagge geschaffen, bestehend in der deutschen Nationalflagge mit dem Landeswappen ohne Reichsadler in der Ecke des schwarzen Streifens am Flaggenstock. Diese Flagge wird nicht nur von den Behörden, sondern vielfach auch von Privaten geführt und zwar, wie man dies bei jeder Beflaggung an festlichen Tagen feststellen kann, in zunehmendem Maße. Es mag unerörtert bleiben, wie viel dabei auf Kosten der Fahnenfabriken zu setzen ist, die diese Flagge als elsass-lothringische anpreisen und verkaufen. In der Literatur ist von einer einheitlichen Flagge sozusagen gar keine Rede. Es wird immer nur die Fahne vom Elsass und diejenige von Lothringen getrennt geschrieben und dargestellt, wobei für Elsass lediglich das Wappen für Oberelsass ins Auge gefasst wird. Demgemäß werden als die Farben von Elsass rot-gelb angegeben. Die Farben werden also ganz richtig nach den oben entwickelten Regeln aus dem Wappen hergeleitet. Auffallend ist, dass übereinstimmend für Elsass nur das Wappen und die Farben für Ober-Elsass bekannt zu sein scheinen, obwohl dieses gegenüber dem unterelsässischen Wappen das jüngere ist. Was die Lothringer Farben anlangt, so werden die alérions im Lothringer Wappen als „Beizeichen“ behandelt und nicht berücksichtigt mit Ausnahme eines Falles, wo die Farben des Hauses Lothringen als gelb-rot-weiß angegeben werden. Endlich findet sich in der Literatur noch eine Stelle, wo gelegentlich der Kritik des neuen Wappens des Reichslandes die Farben desselben mit weiss-rot-gelb bezeichnet werden. Abgesehen von diesen beiden Zitaten kennt die Literatur, soweit sie mir zugänglich ist, für die Fahnen des Elsass und von Lothringen nur die beiden Farben gelb und rot. Ganz anders in der Praxis. So übereinstimmend die Theorie als gegebene Farben Gelb und Rot versicht, so übereinstimmend zeichnet sich die Praxis dadurch aus, dass sie niemals diese Farben verwendet. Die allgemein beliebte Farbenzusammenstellung ist nämlich bekanntermaßen nicht gelb-rot oder rot-gelb sondern rot-weiss. Diese Farben trifft man überall, in Städten wie auf dem Lande, im Zentrum des Verkehrs wie im entlegensten Dorfe, bald wagerecht in deutscher, bald senkrecht in französischer Weise, bald rot-weiß, bald weiß-rot, bald helleres, bald dunkleres Rot, also in allen möglichen Variationen. Daneben gelten in Lothringen blau-weiß als spezifisch Lothringer Farben, werden aber in jüngster Zeit allmählich von den elsässischen rot-weißen zurückgedrängt. Die Sachlage ist also heute die, dass ein Elsass-Lothringer, der sein Haus beflaggen will, je nach Geschmack und Herkunft zwischen schwarz-weiß-rot, gelb-rot, rot-gelb, weiß-rot-gelb, gelb-weiß-rot, rot-weiß, weiß-rot und blau-weiß wählen, oder aber, vorausgesetzt, dass die Front groß genug ist, sämtliche ebenangeführten Fahnen nebeneinander aushängen kann. Dieser Wirrwarr zeit zur Genüge, dass es höchste Zeit ist, wenn in dieser Frage Klärung und Ordnung geschaffen wird. Nachdem Elsas und Lothringen unzertrennbar verbunden, nachdem sie den Bundesstaaten sozusagen gleichgestellt sind, nachdem sie ein einheitliches Wappenzeichen erhalten haben, ist es eine logische Forderung, dass ihnen nunmehr auch eine einheitliche Flagge verliehen werde. Wie soll nun dieselbe aussehen? Prüfen wir zunächst kritisch die ebengeschilderte tatsächliche Sachlage. Wir haben zunächst die Landesdienstflagge. Dieselbe ist, wie oben angeführt, zunächst lediglich den elsass-lothringischen Landesbehörden verliehen worden und zeigt die Reichsfarben, aber mit einem partikularistischen Obereck. Diese Flagge ist für Behörden, die "elsass-lothringische Landesbehörden“ mit dem Titel von "kaiserlichen“ sind, äußerst passend und kennzeichnet in ihrer Zusammensetzung sofort die Stellung der amtlich zu ihrer Führung Berechtigten. Aber gerade deshalb scheidet sie für unsere Frage völlig aus, ganz abgesehen davon, dass es ein nie dagewesener Vorgang wäre, wenn die Dienstflagge einer Behörde zur Landesflagge erklärt würde. Auch aus praktischen Gründen wäre eine Flagge mit Wappendarstellung in der Ecke zu verwerfen. Die Flagge soll, wenn sie allgemein und von jedem in Anwendung gebracht werden will, einfach sein und aus reinen Farbenstreifen bestehen, wie dies auch, von Oldenburg und vielleicht Hamburg abgesehen, bei sämtlichen übrigen Bundesstaaten der Fall ist. Die Anbringung eines Wappens erfordert immer besondere Ausgaben, während die gewöhnlichen Flaggen von jedermann hergestellt werden können. Außerdem muss, wenn einfach Flagge volkstümlich werden soll, ihre Benennung einfach und geläufig sein. Nur so können die Farben Gemeingut des Volkes werden, so wie die Preußen singen können: „Ich bin ein Preuße, kennt Ihr meine Farben?”. Gegebenenfalls müsste der Elsass-Lothringer dies bekannte Lied von Thiersch wie folgt ummodeln: „Ich bin Reichsländer, kennt Ihr meine Farben? Die Fahne weht mir schwarz-weiß-rot mit elsass-lothringischem Wappenschild im rechten Obereck voran!“ Nun könnte man aber unter Weglassung des Wappenschildes die Farben von Elsass-Lothringen einfach las schwarz-weiß-rot annehmen. Es scheint dies auf den ersten Blick schon deshalb als gegebene Lösung, weil unser Land als „Reichsland“ dem Reiche unmittelbar angegliedert ist und daher naturgemäß auch seine Farben zu führen hätte. Aber auch dieser Weg ist nicht gangbar, vor allem Dingen deshalb nicht, weil in diesem Falle die Farben des Reichslandes mit denen des Reichs identisch wären, also gerade der Zweck, den wir erstreben, ein prägnantes Unterscheidungsmerkmal von den anderen Bundestaaten zu haben, illusorisch gemacht würde. Gerarde die Suche nach einer Flagge, die uns in unserer Landeszugehörigkeit von den anderen Bundesstaaten im einzelnen und vom dem Reiche als Ganzes unterscheidet, hat zu dieser Musterkarte von Farben für das Reichsland geführt, wie sie heute haben. Würde man die Nationalflagge zur Landesflagge erklären, so wären wir dadurch keinen Schritt weiter gekommen und das Bedürfnis nach einer „eigenen“ einer „besonderen“ Flagge würde nach wie vor bestehen und immer dringender werden. Dazu kommt noch, dass die Stellung von Elsass-Lothringen zum Reiche und gegenüber den anderen Bundesstaaten sich seit der neuen Verfassung denn doch etwas verschoben hat, so dass das Reichsland heute doch wohl etwas mehr bedeutet, als man gleich nach 1870, als der „Glacis“-Standpunkt noch herrschte, darunter verstand. Die Vorschläge der Theoretiker (gelb-rot oder rot-gelb) kommen deshalb nicht, weil sie, wie wir oben gesehen, Unter-Elsass ganz ausser acht lassen, auch - offenbar in der Neigung, nur zweifarbige Fahnen zu geben — die Wappenbilder des Lothringer Wappens nicht genügend berücksichtigen, hauptsächlich aber deshalb, weil sie uns getrennte Farben angeben, uns also bei der Verfolgung unseres Ziels, eine einheitliche Flagge zu finden, nicht entgegenkommen. Dabei ist allerdings zu bemerken, dass die erwähnten Angaben alle aus der Zeit vor Schaffung eines gemeinsamen Wappenbildes für Elsass-Lothringen stammen, der veränderten Lage also nicht Rechnung tragen konnten. Immerhin weist diese Gruppe den einzig gangbaren Weg, die Anlehnung nämlich an das Wappen. Es bleibt also nur noch die praktisch am meisten verwendete Fahne, diejenige, die heute schon im Volke allgemein als die „elsässische" gilt und im Begriffe ist, auch Lothringen zu erobern. Hier müssen wir zunächst die Frage näher untersuchen: wie ist diese Fahne entstanden ? Vor dem Jahren 1870 konnte von einer elsass-lothringischen Fahnen ebenso wenig die Rede sein, wie von einem gemeinsamen Wappen, aus dem natürlichen Grunde, weil ein Elsass-Lothringen als solches noch nicht bestand. Aber auch von spezifisch elsässischen oder lothringischen Fahnen hören wir nichts. Die straffe Zentralisation der französischen Verwaltungsmethode hatte allmählich etwa vorhandene partikularistische Neigungen der alten Provinzen zu unterdrücken gewusst und ließ neue nicht mehr aufkommen. Die einzelnen Departements, die stellenweise ohne Rücksicht auf die historische Vergangenheit gebildet wurden, hatten erst recht kein Bedürfnis zu eigenen Flaggen. Der Einheitsstaat, zu dem sich Frankreich seit der großen Revolution ausgebildet hatte, erweckte bei seinen Bürgern vor allem das Gefühl, Franzosen zu Einheitlichkeit der Verwaltung und Gesetzgebung im innern, das gemeinsam vergossene Blut in den großen Kriegen nach außen, dies alles trug dazu bei, dieses Gefühl zu stärken und auszubilden. So kam es, dass die Trikolore, die dreifarbige Nationalflagge Frankreichs, die herrschende wurde, neben welcher andere landsmannschaftliche oder städtische Farben kaum zur Geltung oder in Anwendung kamen. Dies alles änderte sich von Grund aus nach Eintritt der politischen Umwälzung. Elsass-Lothringen bildete jetzt ein Land für sich, das Reichsland, und wurde einem Staatengebilde angegliedert, das sich aus lauter Einzelstaaten zusammensetzte, die, nur nach außen geschlossen auftretend, im Innern ihre frühere Selbständigkeit mehr oder minder bewahrt hatten und sich ihrer Eigenart und historischen Entwicklung gemäß verschieden ausbildeten und weiterentwickelten. Elsass-Lothringen war nicht mehr integrierender Bestandteil eines Einheitsstaats, sondern adhärierender eines Bundesstaats, der, eben erst geschaffen, seinen Kitt in gemeinsam geführtem Kriege erhalten hatte, in welchem die Krieger des jetzigen Reichslandes ihnen als Feinde gegenüberstanden. Was Wunder, dass da die Nationalflagge des neuen Reichs in den Reichslanden zunächst keinen Anklang und keine Verwendung fand. Es kamen die Zeiten der Trauer um das verlorene Vaterland, des offenen und stillen Protestes, die Zeiten, wo an Kaisergeburtstagen und anderen festlichen Gelegenheiten außer den Flaggen der Behörden andere nicht oder kaum zu sehen waren. Allmählich hatte sich aber das Land aus dieser Übergangsperiode, die wie eine Krankheit auf ihm gelastet, erholt; die vielen Vereine fingen wieder an, ihre Feste zu veranstalten und zu feiern, Ausstellungen wurden organisiert, offizielle Besuche und patriotische Feiern häuften sich. Dies alles führte zu dem Bedürfnis, wieder eine Flagge zu verwenden. Dies Bedürfnis erzeugte aber bei den Eingeborenen ein ganz natürliches Dilemma. Die alte, ihnen vertraute Trikolore durften sie nicht aushängen, die neue Nationalflagge wollten sie zum Teil nicht benutzen, teils aber wünschten sie neben dieser ein spezifisch elsässische zu führen, umsomehr, als sie sahen, wie die vielen Eingewanderten ebenfalls, zum Teil ausschliesslisch, die Farben ihrer Einzelstaaten, denen sie angehörten, verwendeten. Der Partikularismus, den diese letzteren aus ihrer Heimat mitbrachten, musste vorbildend auf die Reichsländer, die denselben nicht mehr kannten, einwirken. Es war nun naturgemäß, dass sich die Augen des Landes nach der Landeshauptstadt wandten, die von Anfang an mehr Gelegenheit hatte zur Verwendung von Flaggen, um zu sehen, wie sich diese aus diesem Dilemma geholfen. Und wie hatte diese es gemacht? Straßburg hatte einfach in Ermangelung einer Landesflagge seine Stadtfarben ausgehängt und das Rot-Weiß seiner Fahne wurde um so williger im Lande adoptiert, als auch andere Städte, so z. B. Mülhausen, Schlettstadt, Münster, Gebweiler oder Weißenburg, Zabern, Ensisheim, Sennheim rot-weiß bzw. weiß-rot als ihre Stadtfarben ansprechen konnten. Dazu kam, dass auch die Farben der Landgrafschaft Unter-Elsass weiß-rot sind, obwohl wir diesen Umstand kaum mit in die Wagschale legen dürfen. Auch Lothringen fühlte das Bedürfnis nach einer eigenen Flagge: bezeichnenderweise war anfangs das Gefühl der Zusammengehörigkeit mit dem Elsass noch so wenig entwickelt, dass die Lothringer nicht nur keine einheitliche Flagge mit dem Elsass erstrebten, sondern Farben wählten, die von den elsässischen ganz abwichen: blau-weiß, die andere Hälfte der „Trikolore“, wäre man beinahe versucht beizufügen. Woher diese Farben stammen, ist mir unbekannt; weder im lothringischen Stamm- noch Staatswappen kommt blau-weiß vor und von den lothringischen Städten hat blau-weiß keine, weiß-blau nur Finstingen. In letzter Zeit kommen, wie oben erwähnt, auch die so genannten Elsässer Farben mehr und mehr zur Anwendung, auch hier getragen von dem Rot-weiß oder Weiß-rot Lothringer Städte, wie Vic und Saarburg einerseits, Dieuze und Château-Salins andererseits. Sind nun diese Farben berechtigt und berufe künftige offizielle Landesflagge zu bilden? Das Blau-Weiß der so genannten Lothringer Fahne darf wohl gleich aus der Untersuchung der Frage ausscheiden. Für die rot-weißen Farben könnte man ins Feld führen die große Verbreitung, die sie im Lande gefunden und ihre fast allgemeine Anerkennung als "Elsässer" Fahne, die ihr sogar in der Dichtung schon einen Platz eingeräumt hat. Andererseits ist nicht zu verkennen, dass diese Farben ihre allgemeine Geltung nicht nur dem gesunden Partikularismus, von dem wir eingangs sprachen, verdanken, sondern zum nicht geringen Teile einer ins Politische übergreifenden Opposition, und dass sie daher im Begriffe sind, die Farben und das Symbol einer Partei zu werden, also für die Allgemeinheit ausscheiden. Dazu kommt, dass sie lediglich die Farben einer Stadt oder vielleicht höchstens eines Bezirks bilden, dass sie auch im Lande selbst nur als "elsässische" empfunden werden, während wir die Schaffung einer "elsass-lothringischen" Fahne erstreben. Es wäre ohne Beispiel, dass die Farben der Hauptstadt das Vorbild abgeben für die Farben des ganzen Landes; denn auch die Farben der Stadt Paris sind erst nach Vereinigung mit der Farbe der Kokarde des Königs zur Nationalflagge geworden. Welches soll aber nun die künftige elsass-lothringische Landesflagge sein? Da wir glauben dargetan zu haben, dass keine der bisher geführten oder vorgeschlagenen Farbenzusammenstellungen Anspruch erheben darf, die allein geltende zu werden, da wir andererseits der Überzeugung sind, dass das Bedürfnis nach einer offiziellen allgemein anzuerkennenden Flagge besteht, wagen wir es, positive Vorschläge zu machen. Wir wollen dabei vor vornherein alle Gefühlsmomente beiseite lassen, welche für die Beibehaltung der einen oder anderen Flagge sprechen können. Nicht die Frage, welche Farben sind die beliebtesten, nicht die Erwägung, ob diese oder jene Farbe als die spezifisch elsässischen gelten, dürfen uns bei der Beurteilung der Frage leiten, sondern einzig und allein das Gesichtpunkt, welche Farben die geeignetsten zur Repräsentierung des ganzen Landes sind. Um hiernach die neu zu schaffende Fahne zu finden, gibt es aber nur einen einzigen Weg, den wir oben schon geschildert, nämlich die Anlehnung an die Heraldik. Wir haben also die Farben aus dem Wappen des Reichslandes Elsass-Lothringen herzuleiten. Da bemerken wir bekanntlich, dass dieses Wappen aus zwei Teilen zusammensetzt, dem Reichsadler und dem diesem aufgelegten Landesschild. Es erhebt sich daher die Frage, ob das Schwarz des Reichsadlers zu berücksichtigen sei? Wir glauben diese Frage verneinen zu dürfen. Der Reichsadler bildet zwar einen Hauptteil des Wappens, ist aber hier trotzdem nur als Zutat zum eigentlichen „Landeswappen" zu betrachten, als Hinweis auf das „Reich“. Er darf daher hier wohl ausscheiden, wie z.B. auch der preußische Adler des Wappens der Rheinprovinz bei der Fahne dieser letzteren außer Betracht geblieben ist. Es bleibt demnach nur der Brustschild des Reichsadlers als Unterlage. Wenn wir nach den obigen allgemeinen heraldischen Regeln die Farben aus den diesen Schild bildenden drei einzelnen Wappen zusammenstellen, so ergibt sich
Wir haben also zur Bildung unserer Flagge drei Farben, Gelb und Rot und weiß, die wir in wagerechter Stellung anzubringen haben. Wie sind diese Farben zu gruppieren? Beginnen wir mit dem Wappen des Ober-Elsass, als dem (heraldisch) rechts oben stehenden, so erhalten wir folgende Farbenzusammenstellung: gelb-rot-weiß-rot-weiß-rot-gelb. Eine solche siebenstreifige Fahne kann natürlich ernsthaft nicht in Frage kommen, sie würde einen zu exotisch anmuten. Wir müssen daher die doppelt vorhandenen Farbengruppen streichen, so dass übrig bleiben die drei ersten Farbenstreifen gelb-rot-weiß. Diese Zusammenstellung empfiehlt sich auch schon deshalb, weil dadurch die Farben rot-weiß beieinander bleiben, was mit Rücksicht auf ihre Beliebtheit zu begrüßen wäre, und weil die Kombinationen rot-weiß-gelb oder rot-gelb-weiß sich auf allgemein heraldischen Gründen verbieten. Das Resultat unserer Forschung ist also: Die gemeinsame Landesflagge für das Reichsland, die Farben für Elsass-Lothringen seien Gelb-Rot-Weiß! Durch diese Farben erhielte Elsass-Lothringen eine Flagge, die mit keiner der übrigen Bundesflaggen identisch wäre und daher Verwechslungen ausschlösse, die, aus dem gegebenen Wappen hergeleitet, die Farben aller drei Bezirke enthielte, und daher wie keine andere geeignet wäre, unser Land zu repräsentieren. Wohl mutet der Vorschlag vielleicht etwas fremd an, jedoch hat er dies mit allen Neuerungen gemein. Da er sich aber auf das unstreitig vorhandene Bedürfnis gründet, da er aus der wissenschaftlich allein nutzbaren Quelle der Heraldik schöpft, da er offenbar objektiv sich am besten als Landesflagge eignet, so wird er wohl, einmal zur Ausführung gebracht, sicher auch subjektiv sich die Stellung erobern, die ihm als Symbol des Reichslandes Elsass-Lothringen gebührt. |